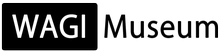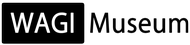Die Limmattal Strassenbahn
Im Archiv des WAGI Museums sind zahlreiche Dokumente, Verträge, Originalbilder und Utensilien der einstigen Limmattal Strassenbahn, kurz L.S.B erhalten geblieben. Die L.S.B und die Wagonsfabrik Schlieren verband seit je her eine tiefe Geschichte.

Niveau Übergang der L.S.B und dem NOB Trasse (Bahnhof Schlieren)
Bereits im Jahre 1893 wurde ein erstes Gesuch um eine Betriebskonzession für eine Strassenbahnstrecke beim Eidgenössischen Parlament eingereicht. Erst am 15. Oktober 1897 wurde schliesslich die Bundeskonzession für eine Strassenbahnlinie von Zürich ab der damaligen Stadtgrenze Zürich-Letzigraben über Altstetten, Schlieren nach Dietikon erteillt. In einer zweiten Phase noch die Strecke mit einem Abzweiger von Schlieren nach Unterengstringen und Weiningen.

L.S.B Motorwagen Nr. 7
Im unmittelbaren Anschluss wurde ein Förderungskomitee bestellt, welchem die Gemeindepräsidenten von Altstetten, Dietikon, Schlieren, Unterengstringen und Weiningen als Ortsvertreter angehörten. Zwei Jahre später nähmlich 1899 wurde die Limmattal-Strassenbahn A.G gegründet, es wurden in der Folge Verträge abgeschlossen mit Brown Bovery & Cie in Baden über den Bau der Bahnanlage im Rahmen des Kostenvoranschlages von CHF 1.080.000.--, mit der Motor AG in Baden betreffend der Übernahme des Obligationenkapitals in Höhe von CHF 650.000.-- sowie mit der Schweizerischen Wagonsfabrik A.G Schlieren über die Abtretung eines Grundstücks als Betriebsareal.
Mit dem Elektrizitätswerk der Stadt Zürich verhandelte man über die Lieferung von Drehstrom an die Umformerstation Schlieren welche so die technische Grundlage für den Betrieb der Limmattal-Strassenbahn schuff. Am 10. April des Jahres 1900 begann der Bau der Bahnanlagen, noch im selben Jahr, am 20. Dezember fand die Eröffnung der Limmattal-Strassen-bahn statt. Gerademal 8 Monate und 10 Tage hatte die Bauzeit für die 8,845 km lange Strecke Zürich Letzigraben bis Dietikon mit 6 Ausweichen und der ganzen Depotanlage gedauert. Mit acht gelb gestrichenen Motorwagen vom Typ Ce 2/2 sowie mit Fahrzeugen zur Güter- und Postbeförderung wurde der Betrieb aufgenommen. Sämtliches Rollmaterial wurde durch die Wagonsfabrik Schlieren und BBC Baden geliefert. Die von BBC verbauten Motoren stammten noch von General Electrics in den USA.
Im Folgejahr konnte dann auf der 3,1 Kilometer langen Strecke Schlieren - Weiningen der Betrieb ebenfalls aufgenommen werden. Probleme gab es beim schon am Bahnhof Schlieren. Die Nordostbahn NOB untersagten der L.S.B, die Schienen zu unterbrechen. Die Reisenden mussten also zu Fuss über die Geleise marschieren. Dort stand ein Wagen für den nächsten Streckenabschnitt bereit. Die Limmat wurde auf einer 64 Meter langen, speziell für den Betrieb der Strassenbahn erstellten Brücke überquert. Die Zufahrtsrampen hatten je eine Länge von 50 Metern.
Die ersten Betriebsjahre der L.S.B wurden durch eine allgemeine Wirtschaftskrise überschattet. Noch 1902 standen Restguthaben der Generalunternehmung und eines weiteren Unternehmers offen. Die damalige Telegraphendirektion war nicht bereit, ihre Rechnung von über CHF 25'000.-- für Leitungsanpassungen zu stunden. Abgesehen von den negativen Betriebsergebnissen stellten die hohen unbezahlten Zinsen ein gewichtiges Problem dar. Der Anteil von Fremdgeldern inklusive der schwebenden Schulden am Anlagekapital der L.S.B war hoch. 1905 stand die LSB bereits vor dem Bankrott.

Ihre Bilanz musste saniert werden, indem einerseits eine Reduktion des Aktienkapitalwerts um CHF 130'000.-- erfolgte und andererseits die aufgelaufenen Zinsschulden von CHF 119'817.-- erlassen wurden. Ein Teil des freigesetzten Kapitals schrieb man 1906 dem Reservekonto gut. Nach weiteren finanziellen Turbulenzen schrieb die LSB 1904 dann erstmals schwarze Zahlen und wies einen Einnahmenüberschuss von CHF 51.-- Franken auf. Insbesondere Einnahmen aus dem Gütertransport, vor allem Bier und Kies, verbesserten um 1906 das Betriebsergebnis. Dennoch wurde 1911 eine durchgreifende finanzielle Restrukturierung notwendig. Der Gütertriebwagen beförderte vornehmlich die privaten Bierwagen der Löwenbrauerei Fleisch in Dietikon welche ebenfalls von der SWS Schlieren geliefert wurden.
Das Jahr 1908 brachte dem Unternehmen eine neue Belastungsprobe, in dem die Entlassung eines fehlbaren Kondukteurs von der Organisation der Strassenbahner nicht anerkannt wurde. Es brach ein Streik aus mit dem Boykott der Arbeiterorganisationen. Der Kampf verlief nicht ohne finanzielle Einbusse für das Unternehmen, nach weiteren Entlassungen der renitenten und aufwieglerischen Mitarbeiter im Betrieb trat wieder Ruhe ein. Die Frequenz der Bahn stellte eine ausserordentliche Belastungsprobe dar,die sie mit Ehren und grossem finanziellen Erfolg bestand. An den drei Festtagen beförderte sie zirka 46000 Personen. Die Gesamtbetriebsresultate waren aber immer noch derart, dass die Stundungfrage der Obligationenzinse hätte beseitigt werden können.

L.S.B Xe 101 im Gelände der Wagonsfabrik Schlieren
Sechs Jahre später, 1916, wurde bei den Fahrgastzahlen erstmals die Millionengrenze übertroffen. Einen Benutzerrekord erzielte die LSB 1920: Die Limmattaler Strassenbahn transportierte in diesem Jahr 2.253.265 Personen, die höchste Zahl in der gesamten Betriebsgeschichte. Zurückzuführen war diese Zahl vor allem auf den Kohlemangel und die damit verbundene Unzuverlässigkeit auf der noch nicht elektrifizierten Strecke der Schweizerischen Bundesbahnen. Die Verwaltung der Bahn war es von Anfang an gewohnt, fortwährend mit Schwierigkeiten zu kämpfen, finanziell oder mit technischen Fragen. Doch in den Jahren nach 1926 war die Situation so schwierig geworden, dass die drei Hauptaktionäre allen Mut und alle Hoffnung verloren.
Wenn auch neue Geldmittel noch hätten aufgetrieben werden können, sowar doch nie eine Rendite zu erwarten, und so benutzten sie die erstbeste Gelegenheit,sich damals ihrer Aktienpakete zu entledigen. Die Tendenz der Stadt Zürich, nach und nach alle Vorortsbahnen in ihren Besitz zu bringen, gab ihnen Hoffnung, noch etwas von den ausgelegten Geldern zurück zu erhalten. So verhandelten im Winter 1929/30 die Brown Boveri AG. und Motor AG. in Baden so wie die Firma Geistlich AG.·in Schlieren über die Köpfe des Verwaltungsrates hinweg ihren gesamten Aktienbesitz an die Stadt Zürich zu verkaufen.
In den Verhandlungen konnte eine Verständigung erzielt werden auf der Basis, dass die Prioritätsaktien einen Kaufpreis von CHF 140.--Franken und die Stammaktien einen Preis von CHF 10.-- erzielten. In diesen Stückpreisen waren die Coupons derJahre 1916 bis 1930 inbegriffen. Die Hauptaktionäre verlangten noch, dass die Stadt auch den übrigen Aktionären dieselben Preise bezahlen. In der Vereinbarung vom 7. Mai verpflichtete sich der Stadtrat, dem Grossrat zu beantragen, das gesamte Aktienkapital zu den obgenannten Stückpreisen zu erwerben, soweit diese Aktien dem Finanzvorstand bis zum 31. Juli 1930 zum Kauf angeboten würden. Der Grossrat stimmte dem am 18.Juni 1930 auch zu.
Der Regierungsratsbeschluss vom 13. November 1930 brachte die Grundlage zum Übergang der L.S.B an die Stadt Zürich. Die Konzession der Strecke Zürich-Schlieren wurde auf die Städtische Strassenbahn StStZ übertragen. Für die Strecken Schlieren-Dietikon und Schlieren-Weiningen, so weit dies noch nicht geschehen, wurde die Konzession in der Weise abgeändert, dass sie künftig als Kraftwagenkurse betrieben werden konnten. Die Konzessionärin wurde verpflichtet, auf beiden Strecken einen Autobusbetrieb einzurichten, den sie bis zum Jahre 1946 (Ablauf der Konzession) aufrecht zu erhalten hatte. Für die Strecke Schlieren-Dietikon war ein 24-Minuten-Betrieb vorgeschrieben.
Die gänzliche Einstellung der Linien Dietikon-Schlieren sowie Schlieren - Unterengstringen-Weiningen war angesichts der sehr schlechten Auslastung der Autobusse angezeigt und war geeignet, die Strassenbahn von weiteren Kosten einer überflüssigen Verkehrsverbindung zu entlasten. Die damalige Auslastung auf diesen Linien war dauernd und zuallen Tageszeiten so schlecht, dass nicht von einem angemessenen und berechtigten Bedürfnis nach dieser Verbindung gesprochen werden durfte.Vorgenommene eingehende Verkehrszählungen haben neben den ganz ungenügenden Einnahmen dies längst dargetan.
Im Rahmen der zeitweise angedachten Umstellung aller Zürcher Trams auf Trolleybusse wurde diese Strecke durch die neue Linie 31 des Trolleybus Zürich von Burgwies über Zeltweg, Hauptbahnhof, Hardplatz und Farbhof nach Schlieren ersetzt, welche anstelle der bisherigen Tramline 1 entstand.